Theorie
Ausgangspunkt der Sonnenuhr bildet eine
äquatorparallele Scheibe mit erdachsenparallelem Zeiger. Der Zeiger der Uhr
schliesst also mit der Horizontalen den Winkel der Geographischen Breite des
Standores ein. Diese wohlbekannte ‚Äquatorialsonnenuhr’ wird also bei positiver
Deklination der Sonne, d.h. im Frühling und Sommer auf der Oberseite beschienen,
bei negativer Sonnendeklination, d.h. im Herbst und Winter wird sie auf der
‚Unterseite’ beschienen.
Der Schatten des Zeigers wandert nun gleichmässig entlang der Scheibe und zwar mit einer Geschwindigkeit von 360/24=15 Grad/Stunde. Zur Angabe der Zeit bringt man also am Rand der Uhr eine Skala mit Stundenziffern im gleichmässigen Abstand von 15 Grad an.
Diese Uhr ist ‚universal’, d.h. will man sie an einen Ort anderen Breitengrades versetzen muss man lediglich ihre Neigung verändern. Will man sie an einen Ort anderen Längengrades versetzen muss man die Skala lediglich um die Zeigerachse verdrehen.
Dies ist eine ästhetischer Vorteil gegenueber den Vertikaluhren (z.B. an Hauswänden) oder Horizontaluhren, bei welchen die Stundenlinen keine gleichmässigen Winkel zeigen, d.h. bei denen die Skala nur für den gegebenen Breitengrad und Längengrad richtig ist.
Eine weiterer Vorteil der äquatorialen Scheibe ist die Möglichkeit den Zeiger zugleich als Mittagsweiser zu verwenden. Bringt man nämlich auf der Scheibe eine Weltkarte in polarer Projektion an, so gibt das Zentrum des Zeigerschattens denjenigen Längengrad auf der Weltkarte an auf dem die Sonne gerade die Mittagslinie durschreitet. Weiters zeigt diese Uhr die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an.
Nun weicht aber die Zeit, welche eine solche Sonnenuhr, bzw. jede Sonnenuhr mit erdachsenparallelem Zeiger und geraden Stundenlinien anzeigt, im Laufe des Jahres bis zu ±16 Minuten von der mittleren oder ‚bürgerlichen’ Zeit, welche unsere Uhren anzeigen, ab. Der Grund dafür liegt in der Erdachsenneigung gegen die Erbahnebene und der ungleichförmigen Bewegung der Erde um die Sonne, welche durch die Keplerschen Gesetze definiert ist. Die Sonnenuhrzeit ist also kein ‚gleichmässiges’ Zeitmass. Die Abweichung der Sonnenuhrzeit von der mittleren Zeit wir Zeitgleichung bezeichnet.
Da aber die Sonne nun jeden Tag ihre Deklination ändert, d.h. an jedem Tag des Jahres ein anderer Punkt des Zeigers einen Schatten auf den Rand der äquatorialen Scheibe wirft, hat man die Möglichkeit diese Zeitglichung durch eine spezielle Form des Zeigers zu korrigieren.

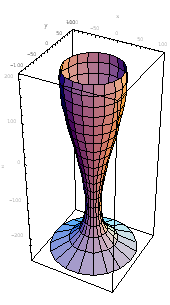
Für diese Korrektur sind zwei Zeiger nötig, da die Sonne zweimal pro Jahr die gleiche Deklination aufweist. Deshalb muss der Zeiger, zweimal pro Jahr gewechselt werden, was bedingt dass die Ausführung dieser Uhr meist recht klein gehalten werden muss.
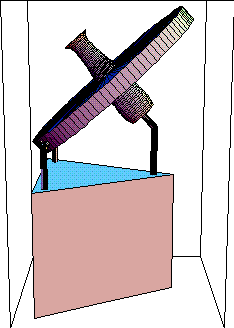
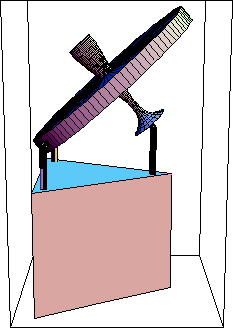
Hier kommt nun die Neuerung der Solarcity-Uhr in Spiel. Anstatt zweier Einzelzeiger, die ausgewechselt werden müssen, werden beide Zeiger simultan angebracht, wobei der jeweils dickere Teil des Zeigers ‚halbdurchlässig’ ist und somit ein Halbschatten und ein Vollschatten erzeugt wird. Welcher der Schatten zum gegebenen Datum gültig ist wird einer Skizze an der Skala der Uhr entnommen. Die folgenden Bilder wurden mit AutoCad erstellt und die 'semi-transparenz' wurde durch schneiden einer Helix in den äusseren Teil des Zeigers erzielt.
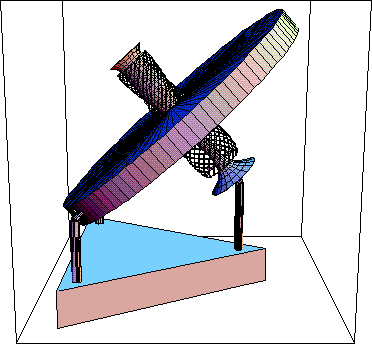
21. Dezember 3. Februar
19. Februar 14. März
12. April 26. April
14. Mai 21. Juni
Such an uninterrupted helix slit on the outer indicator is however not mechanically stable. A stable realization of the indicators which was reasonable to produce is shown in the next pictures.
Eine weitere Neuerung der Solarcity Sonnenuhr ist die Anzeige des Datums. Der Rand der Scheibe wirft einen Schatten auf den Zeiger der Uhr. Somit kann durch Anbringen einer Datumskala auf dem Zeiger das aktuelle Datum abgelesen werden
Da die Zeitgleichung eine eindeutige Funktion der Bewegung der Erde bezüglich der Sonne ist, verkörpert dieser Doppenzeiger in zwingender Form und vollständig die Beziehung der Erde zur Sonne. Insbesondere verkörpert er also auch die Keplerschen Gesetze, was einen interessanten Bezug zu Linz herstellt. Johannes Kepler lebte ja von 1612-1626 in Linz wo er einer seiner Hauptwerke, die ‚Weltharmonik’ schrieb.